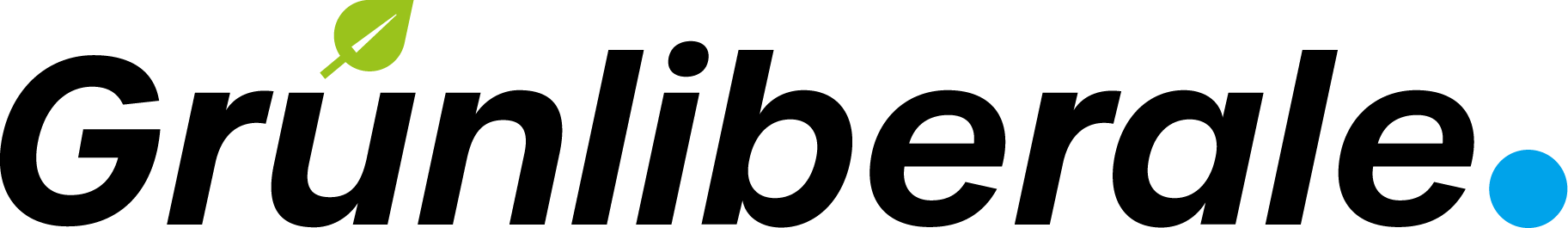Am 7. März gelangt die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» zur Abstimmung. Die Initiative vermag nicht zu überzeugen. Sie widerspricht den Prinzipien eines liberalen Rechtsstaates.
Die Initiative will, dass auf Verfassungsstufe vorgeschrieben wird, welche Kleidung die Bevölkerung zu tragen hat und welche nicht. Damit wird in unverhältnismässiger Weise in Grundrechte eingegriffen. Das Verhüllungsverbot soll dazu dienen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und die Mindestvoraussetzungen für das «Zusammenleben» zu bewahren. Es soll sichergestellt werden, dass bei zwischenmenschlicher Interaktion das Gesicht des Gegenübers nicht verdeckt werden darf. Das Tragen von Niqab oder Burka ist in der Schweiz aber kaum verbreitet. Gelegentlich sind ausländische Touristinnen anzutreffen, die sich verhüllen. Wegen dieser wenigen Fälle (die Personen betreffen, die sich nur temporär auf schweizerischem Staatsgebiet aufhalten) die Freiheitsrechte der Gesamtbevölkerung auf Verfassungsebene einzuschränken, ist abwegig. Die Initiative vermag kaum einem praktischen Zweck zu dienen und ist als eigentliche Kleidungsvorschrift einzustufen. Der Initiative mutet daher auch etwas anachronistisch an, zumal solche Vorschriften im Mittelalter verbreitet waren und dann später entfielen.
Soweit die Initiative will, dass keine Person gezwungen werden darf, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen, ist sie überflüssig. Art. 10a Abs. 2 gemäss Initiativtext dürfte sich mit dem Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB decken. Der Begriff des Zwanges, der in beiden Bestimmungen verwendet wird, ist der Gleiche. Dass das Gleiche zweimal geregelt wird, ist unnötig.
Ferner dürfte die Initiative auch schwierige Vollzugsfragen stellen, wie bspw. die Frage, ob sich eine Touristin verhüllen darf, wenn sie ein Attest ihres arabischen Hausarztes vorweisen kann und wie und mit welchem Aufwand in solchen Fällen Untersuchungen geführt werden.
Rolf Kuhn, GLP Bezirksratskandidat, Mettmenstetten
Replik zum Thema am 10. Februar 2021
Frau Caldwell greift in Ihrem Leserbrief vom 5.2. das Thema auf, wie Hooligans beizukommen sei, wenn ein Rechtsstaat eine Verhüllung des Gesichts im öffentlichen Raum akzeptiert.
Ein Rechtsstaat kann Hooliganismus nicht tolerieren. Dem Rechtsstaat stehen zur Bekämpfung von vermummten Hooligans aber bereits heute gesetzliche Instrumente zur Verfügung:
Fussball-Hooligans agieren vorab in Zürich, Basel und in anderen Städten. Zudem sind Aktivisten der extremistischen Szene ähnlichen Gruppierungen zuzuordnen. Diese sind ebenfalls in grösseren Städten aktiv.
Soweit der Kanton Zürich betroffen ist, gilt das Vermummungsverbot gemäss § 10 des Straf- und Justizvollzugsgesetzes (in Basel besteht eine ähnliche Regelung). Dieses stellt denjenigen unter Strafe, der sich bei Versammlung, Demonstrationen und Menschenansammlungen auf öffentlichem Grund unkenntlich macht. Da die genannten Gruppierungen üblicherweise als «Ansammlung» auftreten, können Hooligans bei Vermummung bestraft werden. Weiter kennt das Strafgesetzbuch Tatbestände (Sachbeschädigung, Drohung gegen Beamte etc.), welche relevant sind.
Täter können bestraft werden. Die Frage, ob dies gelingt ist eine Frage des Vollzugs. Die Durchsetzung des bestehenden Verbos war nicht immer optimal, was auch verschiedentlich kritisiert wurde. An diesem Problem ändert man nichts, indem man auf eidgenössischer Ebene noch einmal ein Vermummungsverbot erlässt. Die Frage, wann die Ausübung von Polizeigewalt bei unzulässiger Vermummung angezeigt ist, ist heikel. Je nach Eskalationsgefahr muss abgewogen werden, ob ein Einsatz verhältnismässig ist. Polizeibeamte oder Dritte können bei Eskalation erheblichen Gefährdungen ausgesetzt werden. Das Abwägen ist keine einfache Aufgabe. Durch ein zweites (und somit eigentlich überflüssiges) Vermummungsverbot wird die Aufgabe nicht einfacher gemacht. Die gesetzliche Grundlage, um bei Hooliganismus durchzugreifen, besteht heute schon. Die fehlende Grundlage ist nicht das Problem, sondern der Vollzug.
Rolf Kuhn, GLP Bezirksratskandidat, Mettmenstetten